English version below
Die letzte Woche unserer Expedition ist angebrochen und wir haben die Labradorsee in Richtung Osten verlassen. Die verbleibenden Tage werden wir mit Messungen der CTD-Rosette verbringen. Sie besteht aus einem Kranz von Flaschen, mit denen wir Wasserproben nehmen können und zusätzlichen Messgeräten, die darunter angebracht sind. Die eigentliche CTD (die Abkürzung steht für: Conductivity = Leitfähigkeit, Temperature = Temperatur, Depth = Tiefe) ist ein Messgerät an der Unterseite der Rosette. Zusätzlich gibt es noch eine kleine Kamera, die Bilder aufnehmen kann und ein Messgerät, das Fluoreszenz misst. An bestimmten Positionen müssen wir dann das Schiff anhalten und lassen die Rosette an einem Kabel bis zum Boden hinab. Bei Wassertiefen, die teilweise über 3000m betragen, kann es bis zu 2 Stunden dauern, bis die CTD-Rosette nach unten und wieder nach oben gefahren ist.
Die geplanten CTD-Stationen sollten uns Stück für Stück Richtung Grönländischer Küste führen. Die küstennahen Messungen sind dabei besonders interessant, um ähnlich wie in der Labradorsee den tiefen Randstrom zu untersuchen. Doch bei diesem Plan machte uns das Eis einen Strich durch die Rechnung. Auf der einen Seite freuten wir uns über die Schönheit der zahlreichen Eisschollen um uns herum, auf der anderen Seite verhinderten sie leider auch unser Vorankommen zu den küstennahen CTD-Stationen.

Aus dem Film Titanic haben wir alle gelernt: So ein Eisberg kann zum fatalen Problem für ein Schiff werden. Aber ist das eigentlich noch aktuell? Laut Kapitän Björn Maaß, können Eisberge heutzutage durchaus noch Schiffe versenken. Wir haben allerdings einen Vorteil, gegenüber der Titanic: das Radar, auf dem man Eisberge sehr gut erkennen kann. Nicht so gut erkennbar sind allerdings die von Eisbergen abgebrochene kleinere Eisstücke, Growler genannt. Growler (wortwörtlich übersetzt Brummer) sind nach dem Geräusch benannt, das sie beim Aus- und Abtauchen in der See verursachen. Teilweise sind sie schon mehrere Jahre unterwegs, weshalb sie häufig aus härterem Eis bestehen und nicht so weit aus dem Wasser schauen, da sie schon rundgewaschen sind. Um auch die Growler im Blick zu behalten, ist es deshalb wichtig zusätzlich zur Radarbeobachtung auch aus dem Fenster zu schauen, um alles im Blick zu behalten.
Damit kommen wir zu dem Problem, das unsere CTD-Messungen verhinderte. Es ist nämlich nicht nur das Eis, sondern die Kombination aus Eis und schlechten Sichtverhältnissen, die zur Gefahr wird. Zu Beginn der Stationsarbeit hatten wir Nebel aber nur wenig Eis. Später klarte es auf und das Eis wurde mehr. Solange die Sicht gut ist, sind bis zu 70-80% Bedeckung der Wasseroberfläche mit Eis noch in Ordnung, so der Kapitän. Doch der erneut aufziehende Nebel verringerte die Sicht drastisch. Solange die CTD-Rosette im Wasser ist, ist das Schiff in der Manövrierfähigkeit eingeschränkt und könnte damit einem auf das Schiff zutreibenden Eisberg schlecht ausweichen. Selbst nah am Schiff vorbei treibende Eisberge können zur Gefahr werden. Wie allgemein bekannt, befindet sich der Großteil eines Eisberges unter Wasser. Durch Abtauen des Eises kann es zur Verlagerung der Gewichtsverteilung und damit zum Drehen oder Kippen des Eisberges führen. Sollte das in der Nähe des Schiffes passieren, kann es zu einer Kollision kommen.

Vielleicht fragt sich an diesem Punkt der ein oder andere: ist die Maria S. Merian nicht ein Eisbrecher? Wieso ist das Eis dann überhaupt ein Problem? In der Nord- und Ostsee, wo man es nur mit einjährigem Eis zu tun hat, kann sie tatsächlich bis zu 80cm Eis brechen. In dem Gebiet, in dem wir uns jetzt befinden, kann es aber durchaus sein, dass sich eingeschlossen im einjährigen Eis auch ältere Stücke befinden. Diese haben bereits einen oder mehrere Sommer überstanden und sind dadurch schon mehr verdichtet und damit härter. Versucht man dieses dann zu brechen, kann das Schiff beschädigt werden. Das führte mutmaßlich zum Untergang des Kreuzfahrtschiff Explorer 2007 in der Antarktis. Die Besatzung des Schiffes war auf der Nord- und Ostsee ausgebildet und damit nur im Umgang mit einjährigem Eis geschult.
Fassen wir also kurz zusammen: Eisberge sind auch heutzutage noch eine Gefahr für die Seefahrt. Dank Radar kann man das Eis zwar sehr gut beobachten, doch die Sichtverhältnisse sollten trotzdem möglichst gut sein, wenn man sich in einem Eisfeld befindet. Außerdem ist nicht jedes Eis gleich und muss auf Grund des Alters, der Form und der Größe differenziert betrachtet werden.

Bleibt nur noch die Frage, was passieren würde, sollte unser Schiff die Maria S. Merian doch einmal mit einem Eisberg zusammenstoßen. Das kann auch der Kapitän nicht so leicht beantworten. Zuerst einmal ist die Geschwindigkeit des Schiffes ein wichtiger Faktor. Bei einer Kollision mit 2 Knoten Fahrt, würden die Eisstücke höchstwahrscheinlich nur zur Seite geschoben werden, während ein Zusammenstoß bei 10 Knoten Geschwindigkeit gefährlicher wäre. Außerdem hängen die Auswirkungen eines Zusammenstoßes noch von einigen weiteren Kriterien ab, zum Beispiel wie groß der Schaden ist und wo sich das Loch befindet. Da das Schiff in mehrere Sektionen unterteilt ist, die sie sich wasserdicht voneinander abschotten lassen, kommt es darauf an wie viele und welche Abteilungen volllaufen. Solange nicht Maschinenraum und Windenraum oder nur zwei Sektionen geflutet werden, bleibt die Maria S. Merian schwimmfähig. Für uns bleibt das eine hypothetische Überlegung. Am Ende hatten wir einen atemberaubenden Ausblick, der uns über die verpassten CTD-Stationen hinweggetröstet hat und wurden von der Brücke sicher wieder aus dem Eis herausmanövriert.
The downside of icebergs
The last week of our expedition has dawned and we have left the Labrador Sea towards the east. The remaining days will be spent with measurements of the CTD rosette. It consists of a wreath of bottles with which we can take water samples and additional measuring instruments attached underneath. The actual CTD (abbreviation stands for Conductivity, Temperature, Depth) is a measuring device on the underside of the rosette. In addition, there is a small camera that can take pictures and a meter that measures fluorescence. At certain locations we then have to stop the ship and drop the rosette on a cable down to the ground. At water depths, some of which are over 3000m, it can take up to 2 hours for the CTD rosette to go down and back up.
The planned CTD stations should lead us step by step towards the Greenland coast. The measurements near the shore are particularly interesting to study the deep margin current, as in the Labrador Sea. But with this plan, the ice broke our hearts. On the one hand we enjoyed the beauty of the numerous ice floes around us, on the other hand they unfortunately prevented our progress to the coastal CTD stations.

We all learned from the movie Titanic: an iceberg like this can become a fatal problem for a ship. But is this really still relevant? According to Captain Bjorn Maas, icebergs can still sink ships today. However, we have one advantage over the Titanic: the radar, on which you can see icebergs very well. However, smaller pieces of ice broken off by icebergs, called growlers, are not so well visible. Growlers are named for the noise they make when they go out and dive in the sea. Some of them have been floating around for several years, which is why they often consist of harder ice and do not look as far out of the water as they have already washed around. In order to keep an eye on the growlers, it is therefore important to look out the window in addition to radar observation to keep an eye on everything.
This brings us to the problem that prevented our CTD measurements. It is not just the ice, but the combination of ice and poor visibility that becomes the danger. At the beginning of the station work we had fog but only a little ice. Later, it cleared up and the ice became bigger. As long as visibility is good, up to 70-80% coverage of the water surface with ice is still fine, according to the captain. But the re-emerging fog drastically reduced visibility. As long as the CTD rosette is in the water, the ship is limited in maneuverability and could thus badly dodge an iceberg drifting towards the ship. Even icebergs drifting close to the ship can become a hazard. As is common knowledge, most of an iceberg is underwater. By thawing the ice, it can shift the weight distribution and thus turn or tip the iceberg. If this happens close to the ship, there may be a collision.

At this point, some may wonder: isn’t the Maria S. Merian an icebreaker? Why is ice a problem? In the North and Baltic Seas, where you only have to deal with one year old ice, it can actually break up to 80cm of ice. In the area in which we are now, however, it may well be that there are older pieces trapped in the one-year ice. These have already survived one or more summers and are therefore already more compacted and thus harder. If you try to break it, the ship can be damaged. This led to the sinking of the cruise ship Explorer in Antarctica in 2007. The crew of the ship was trained in the North and Baltic Seas and thus trained only in handling one year’s worth of ice.
So let’s summarize briefly: icebergs are still a danger to shipping today. Thanks to radar you can observe the ice very well, but the visibility should still be as good as possible when you are in an ice field. In addition, not all ice cream is the same and needs to be considered differentiated based on age, shape and size.

The only question left is what would happen if our ship, the Maria S. Merian, collided with an iceberg. The captain can’t answer that easily. First of all, the speed of the ship is an important factor. In a collision at 2 knots, the pieces of ice would most likely only be pushed aside, while a collision at 10 knots speed would be more dangerous. In addition, the impact of a collision depends on a number of other criteria, such as the size of the damage and where the hole is located. Since the ship is divided into several sections, they are sealed off watertight from each other, it depends on how many and which sections are full. As long as engine room and windroom are not flooded or only two sections are flooded, the Maria S. Merian will remain floating. For us, this remains a hypothetical consideration. In the end, we had a breathtaking view that consoled us over the missed CTD stations and were safely maneuvered out of the ice again from the bridge.
Ocean Acidification
What is the High Seas Treaty and Why Does It Matter?
You may have seen headlines recently about a new global treaty that went into effect just as news broke that the United States would be withdrawing from a number of other international agreements. It’s a confusing time in the world of environmental policy, and Ocean Conservancy is here to help make it clearer while, of course, continuing to protect our ocean.
What is the High Seas Treaty?
The “High Seas Treaty,” formally known as the Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreement, went into effect on January 17, 2026. We celebrated this win last fall, when the agreement reached the 60 ratifications required for its entry into force. (Since then, an additional 23 countries have joined!) It is the first comprehensive international legal framework dedicated to addressing the conservation and sustainable use of the high seas (the area of the ocean that lies 200 miles beyond the shorelines of individual countries).
To “ensure the conservation and sustainable use of marine biological diversity” of these areas, the BBNJ addresses four core pillars of ocean governance:
- Marine genetic resources: The high seas contain genetic resources (genes of plants, animals and microbes) of great value for pharmaceuticals, cosmetics and food production. The treaty will ensure benefits accrued from the development of these resources are shared equitably amongst nations.
- Area-based management tools such as the establishment of marine protected areas (MPAs) in international waters. Protecting important areas of the ocean is essential for healthy and resilient ecosystems and marine biodiversity.
- Environmental impact assessments (EIA) will allow us to better understand the potential impacts of proposed activities that may harm the ocean so that they can be managed appropriately.
- Capacity-building and the transfer of marine technology with particular emphasis on supporting developing states. This section of the treaty is designed to ensure all nations benefit from the conservation and sustainable use of marine biodiversity through, for example, the sharing of scientific information.
Get Ocean Updates in Your Inbox
Sign up with your email and never miss an update.
Why is the High Seas Treaty Important?
The BBNJ agreement is legally binding for the countries that have ratified it and is the culmination of nearly two decades of negotiations. Its enactment is a historic milestone for global ocean governance and a significant advancement in the collective protection of marine ecosystems.
The high seas represent about two-thirds of the global ocean, and yet less than 10% of this area is currently protected. This has meant that the high seas have been vulnerable to unregulated or illegal fishing activities and unregulated waste disposal. Recognizing a major governance gap for nearly half of the planet, the agreement puts in place a legal framework to conserve biodiversity.
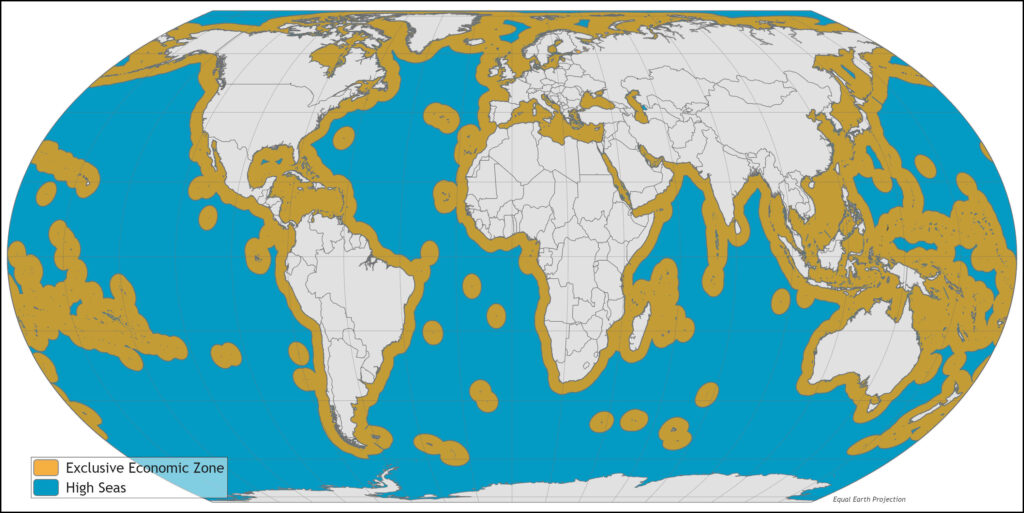
As it promotes strengthened international cooperation and accountability, the agreement will establish safeguards aimed at preventing and reversing ocean degradation and promoting ecosystem restoration. Furthermore, it will mobilize the international community to develop new legal, scientific, financial and compliance mechanisms, while reinforcing coordination among existing treaties, institutions and organizations to address long-standing governance gaps.
How is Ocean Conservancy Supporting the BBNJ Agreement?
Addressing the global biodiversity crisis is a key focal area for Ocean Conservancy, and the BBNJ agreement adds important new tools to the marine conservation toolbox and a global commitment to better protect the ocean.
Ocean Conservancy’s efforts to protect the “ocean twilight zone”—an area of the ocean 200-1000m (600-3000 ft) below the surface—is a good example of why the BBNJ agreement is so important. The ocean twilight zone (also known as the mesopelagic zone) harbors incredible marine biodiversity, regulates the climate and supports the health of ocean ecosystems. By some estimates, more than 90% of the fish biomass in the ocean resides in the ocean twilight zone, attracting the interest of those eager to develop new sources of protein for use in aquaculture feed and pet foods.
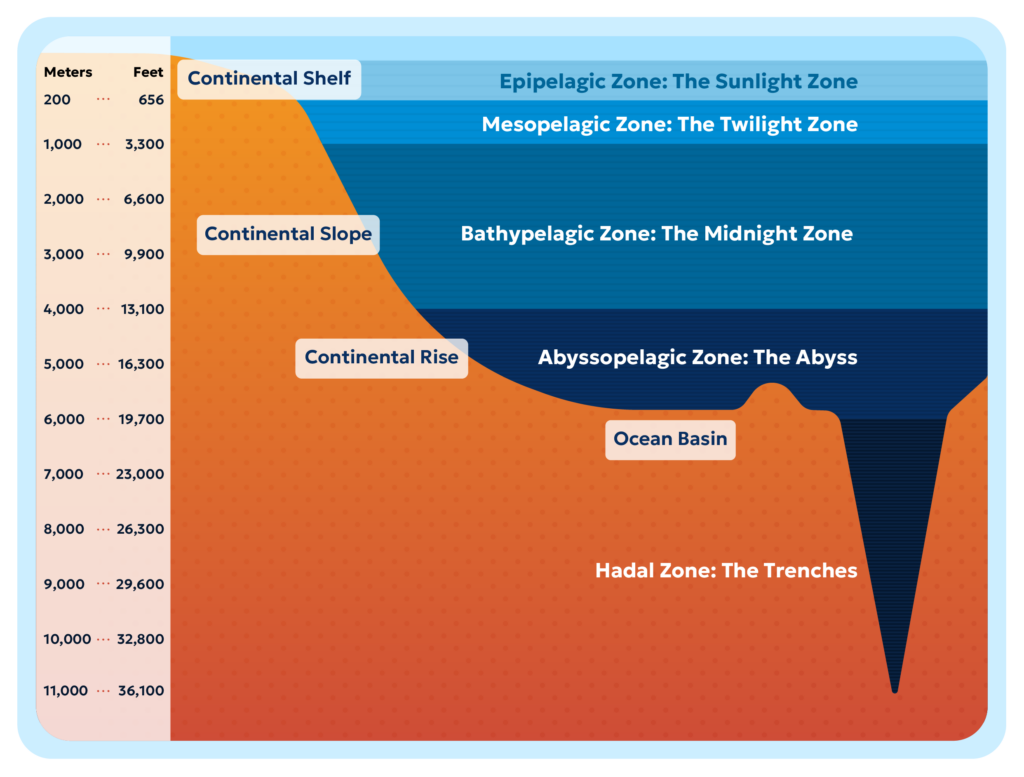
Done poorly, such development could have major ramifications for the health of our planet, jeopardizing the critical role these species play in regulating the planet’s climate and sustaining commercially and ecologically significant marine species. Species such as tunas (the world’s most valuable fishery), swordfish, salmon, sharks and whales depend upon mesopelagic species as a source of food. Mesopelagic organisms would also be vulnerable to other proposed activities including deep-sea mining.
A significant portion of the ocean twilight zone is in the high seas, and science and policy experts have identified key gaps in ocean governance that make this area particularly vulnerable to future exploitation. The BBNJ agreement’s provisions to assess the impacts of new activities on the high seas before exploitation begins (via EIAs) as well as the ability to proactively protect this area can help ensure the important services the ocean twilight zone provides to our planet continue well into the future.
What’s Next?
Notably, the United States has not ratified the treaty, and, in fact, just a few days before it went into effect, the United States announced its withdrawal from several important international forums, including many focused on the environment. While we at Ocean Conservancy were disappointed by this announcement, there is no doubt that the work will continue.
With the agreement now in force, the first Conference of the Parties (COP1), also referred to as the BBNJ COP, will convene within the next year and will play a critical role in finalizing implementation, compliance and operational details under the agreement. Ocean Conservancy will work with partners to ensure implementation of the agreement is up to the challenge of the global biodiversity crisis.
The post What is the High Seas Treaty and Why Does It Matter? appeared first on Ocean Conservancy.
https://oceanconservancy.org/blog/2026/02/25/high-seas-treaty/
Ocean Acidification
Hälsningar från Åland och Husö biological station
On Åland, the seasons change quickly and vividly. In summer, the nights never really grow dark as the sun hovers just below the horizon. Only a few months later, autumn creeps in and softly cloaks the island in darkness again. The rhythm of the seasons is mirrored by the biological station itself; researchers, professors, and students arrive and depart, bringing with them microscopes, incubators, mesocosms, and field gear to study the local flora and fauna peaking in the mid of summer.
This year’s GAME project is the final chapter of a series of studies on light pollution. Together, we, Pauline & Linus, are studying the effects of artificial light at night (ALAN) on epiphytic filamentous algae. Like the GAME site in Japan, Akkeshi, the biological station Husö here on Åland experiences very little light pollution, making it an ideal place to investigate this subject.
We started our journey at the end of April 2025, just as the islands were waking up from winter. The trees were still bare, the mornings frosty, and the streets quiet. Pauline, a Marine Biology Master’s student from the University of Algarve in Portugal, arrived first and was welcomed by Tony Cederberg, the station manager. Spending the first night alone on the station was unique before the bustle of the project began.
Linus, a Marine Biology Master’s student at Åbo Akademi University in Finland, joined the next day. Husö is the university’s field station and therefore Linus has been here for courses already. However, he was excited to spend a longer stretch at the station and to make the place feel like a second home.

Our first days were spent digging through cupboards and sheds, reusing old materials and tools from previous years, and preparing the frames used by GAME 2023. We chose Hamnsundet as our experimental site, (i.e. the same site that was used for GAME 2023), which is located at the northeast of Åland on the outer archipelago roughly 40 km from Husö. We got permission to deploy the experiments by the local coast guard station, which was perfect. The location is sheltered from strong winds, has electricity access, can be reached by car, and provides the salinity conditions needed for our macroalga, Fucus vesiculosus, to survive.

To assess the conditions at the experimental site, we deployed a first set of settlement panels in late April. At first, colonization was slow; only a faint biofilm appeared within two weeks. With the water temperature being still around 7 °C, we decided to give nature more time. Meanwhile, we collected Fucus individuals and practiced the cleaning and the standardizing of the algal thalli for the experiment. Scraping epiphytes off each thallus piece was fiddly, and agreeing on one method was crucial to make sure our results would be comparable to those of other GAME teams.
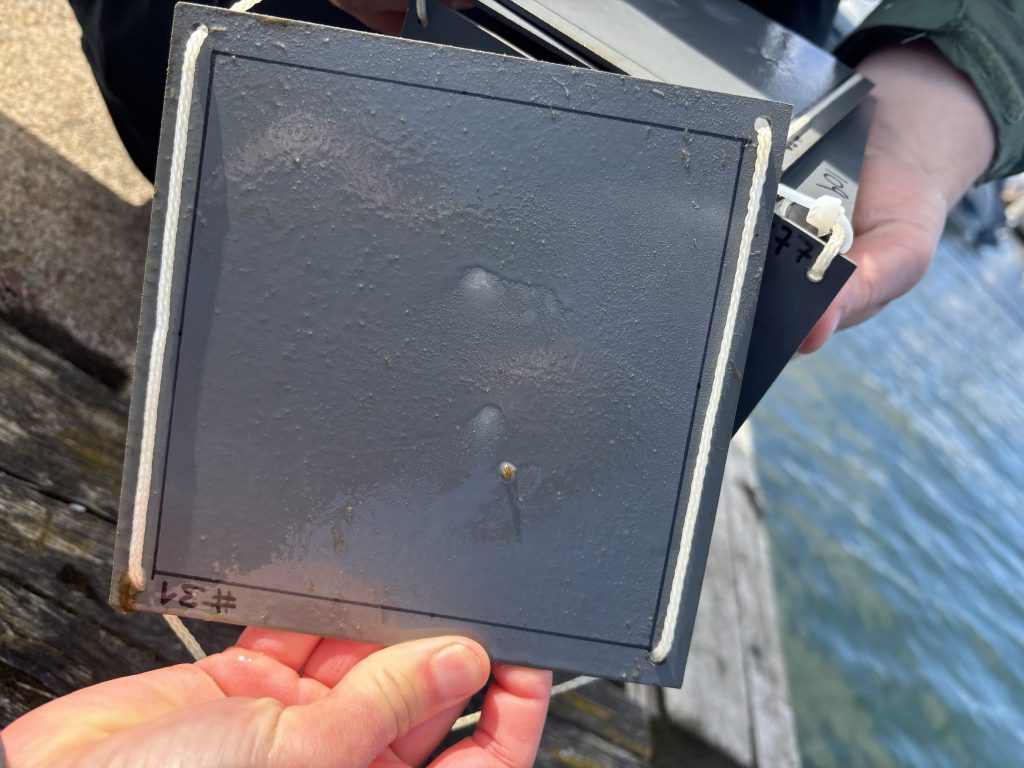
By early May, building the light setup was a project in itself. Sawing, drilling, testing LEDs, and learning how to secure a 5-meter wooden beam over the water. Our first version bent and twisted until the light pointed sideways instead of straight down onto the algae. Only after buying thicker beams and rebuilding the structure, we finally got a stable and functional setup that could withstand heavy rain and wind. The day we deployed our first experiment at Hamnsundet was cold and rainy but also very rewarding!


Outside of work, we made the most of the island life. We explored Åland by bike, kayak, rowboat, and hiking, visited Ramsholmen National Park during the ramson/ wild garlic bloom, and hiked in Geta with its impressive rock formations and went out boating and fishing in the archipelago. At the station on Husö, cooking became a social event: baking sourdough bread, turning rhubarb from the garden into pies, grilling and making all kind of mushroom dishes. These breaks, in the kitchen and in nature, helped us recharge for the long lab sessions to come.

Every two weeks, it was time to collect and process samples. Snorkeling to the frames, cutting the Fucus and the PVC plates from the lines, and transferring each piece into a freezer bag became our routine. Sampling one experiment took us 4 days and processing all the replicates in the lab easily filled an entire week. The filtering and scraping process was even more time-consuming than we had imagined. It turned out that epiphyte soup is quite thick and clogs filters fastly. This was frustrating at times, since it slowed us down massively.
Over the months, the general community in the water changed drastically. In June, water was still at 10 °C, Fucus carried only a thin layer of diatoms and some very persistent and hard too scrape brown algae (Elachista). In July, everything suddenly exploded: green algae, brown algae, diatoms, cyanobacteria, and tiny zooplankton clogged our filters. With a doubled filtering setup and 6 filtering units, we hoped to compensate for the additional growth.
However, what we had planned as “moderate lab days” turned into marathon sessions. In August, at nearly 20 °C, the Fucus was looking surprisingly clean, but on the PVC a clear winner had emerged. The panels were overrun with the green alga Ulva and looked like the lawn at an abandoned house. Here it was not enough to simply filter the solution, but bigger pieces had to be dried separately. In September, we concluded the last experiment with the help of Sarah from the Cape Verde team, as it was not possible for her to continue on São Vicente, the Cape Verdean island that was most affected by a tropical storm. Our final experiment brought yet another change into community now dominated by brown algae and diatoms. Thankfully our new recruit, sunny autumn weather, and mushroom picking on the side made the last push enjoyable.

By the end of summer, we had accomplished four full experiments. The days were sometimes exhausting but also incredibly rewarding. We learned not only about the ecological effects of artificial light at night, but also about the very practical side of marine research; planning, troubleshooting, and the patience it takes when filtering a few samples can occupy half a day.

Ocean Acidification
What is Coral Bleaching and Why is it Bad News for Coral Reefs?
Coral reefs are beautiful, vibrant ecosystems and a cornerstone of a healthy ocean. Often called the “rainforests of the sea,” they support an extraordinary diversity of marine life from fish and crustaceans to mollusks, sea turtles and more. Although reefs cover less than 1% of the ocean floor, they provide critical habitat for roughly 25% of all ocean species.
Coral reefs are also essential to human wellbeing. These structures reduce the force of waves before they reach shore, providing communities with vital protection from extreme weather such as hurricanes and cyclones. It is estimated that reefs safeguard hundreds of millions of people in more than 100 countries.
What is coral bleaching?
A key component of coral reefs are coral polyps—tiny soft bodied animals related to jellyfish and anemones. What we think of as coral reefs are actually colonies of hundreds to thousands of individual polyps. In hard corals, these tiny animals produce a rigid skeleton made of calcium carbonate (CaCO3). The calcium carbonate provides a hard outer structure that protects the soft parts of the coral. These hard corals are the primary building blocks of coral reefs, unlike their soft coral relatives that don’t secrete any calcium carbonate.
Coral reefs get their bright colors from tiny algae called zooxanthellae. The coral polyps themselves are transparent, and they depend on zooxanthellae for food. In return, the coral polyp provides the zooxanethellae with shelter and protection, a symbiotic relationship that keeps the greater reefs healthy and thriving.
When corals experience stress, like pollution and ocean warming, they can expel their zooxanthellae. Without the zooxanthellae, corals lose their color and turn white, a process known as coral bleaching. If bleaching continues for too long, the coral reef can starve and die.

Ocean warming and coral bleaching
Human-driven stressors, especially ocean warming, threaten the long-term survival of coral reefs. An alarming 77% of the world’s reef areas are already affected by bleaching-level heat stress.
The Great Barrier Reef is a stark example of the catastrophic impacts of coral bleaching. The Great Barrier Reef is made up of 3,000 reefs and is home to thousands of species of marine life. In 2025, the Great Barrier Reef experienced its sixth mass bleaching since 2016. It should also be noted that coral bleaching events are a new thing because of ocean warming, with the first documented in 1998.
Get Ocean Updates in Your Inbox
Sign up with your email and never miss an update.
How you can help
The planet is changing rapidly, and the stakes have never been higher. The ocean has absorbed roughly 90% of the excess heat caused by anthropogenic greenhouse gas emissions, and the consequences, including coral die-offs, are already visible. With just 2℃ of planetary warming, global coral reef losses are estimated to be up to 99% — and without significant change, the world is on track for 2.8°C of warming by century’s end.
To stop coral bleaching, we need to address the climate crisis head on. A recent study from Scripps Institution of Oceanography was the first of its kind to include damage to ocean ecosystems into the economic cost of climate change – resulting in nearly a doubling in the social cost of carbon. This is the first time the ocean was considered in terms of economic harm caused by greenhouse gas emissions, despite the widespread degradation to ocean ecosystems like coral reefs and the millions of people impacted globally.
This is why Ocean Conservancy advocates for phasing out harmful offshore oil and gas and transitioning to clean ocean energy. In this endeavor, Ocean Conservancy also leads international efforts to eliminate emissions from the global shipping industry—responsible for roughly 1 billion tons of carbon dioxide every year.
But we cannot do this work without your help. We need leaders at every level to recognize that the ocean must be part of the solution to the climate crisis. Reach out to your elected officials and demand ocean-climate action now.
The post What is Coral Bleaching and Why is it Bad News for Coral Reefs? appeared first on Ocean Conservancy.
What is Coral Bleaching and Why is it Bad News for Coral Reefs?
-
Greenhouse Gases7 months ago
Guest post: Why China is still building new coal – and when it might stop
-
Climate Change7 months ago
Guest post: Why China is still building new coal – and when it might stop
-

 Greenhouse Gases2 years ago
Greenhouse Gases2 years ago嘉宾来稿:满足中国增长的用电需求 光伏加储能“比新建煤电更实惠”
-
Climate Change2 years ago
Bill Discounting Climate Change in Florida’s Energy Policy Awaits DeSantis’ Approval
-
Climate Change2 years ago
Spanish-language misinformation on renewable energy spreads online, report shows
-

 Climate Change2 years ago
Climate Change2 years ago嘉宾来稿:满足中国增长的用电需求 光伏加储能“比新建煤电更实惠”
-
Climate Change Videos2 years ago
The toxic gas flares fuelling Nigeria’s climate change – BBC News
-

 Carbon Footprint2 years ago
Carbon Footprint2 years agoUS SEC’s Climate Disclosure Rules Spur Renewed Interest in Carbon Credits













